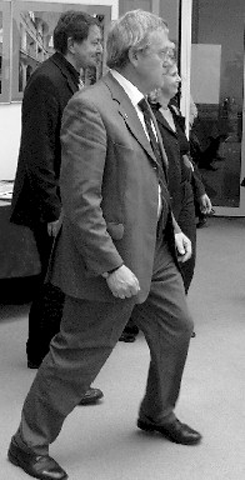Der Staatssekretär und der Kulturpolitische Diskurs der LAKS Hessen.
Seit 2003 ist Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard Staatssekretär im Hessischen Ministerium für Wissenschaft und Kunst. Im Interview mit der LAKS Hessen äußerte er sich zu Themenkomplexen und Begrifflichkeiten wie "freiwillige Leistung" oder "Kultur als Pflichtaufgabe", die in vielen kultur- wie finanzpolitischen Debatten eine Rolle spielen. Bild link: Joachim-Felix Leonhard beim abschließenden Samba auf dem 4. Kulturpolitischen Diskurs der LAKS Hessen.
Herr Leonhard, der breite Bereich der Wirtschaftsförderung ist derzeit weitestgehend unumstritten. Im Gegensatz dazu gerät, obwohl finanziell in deutlich niedrigeren Dimensionen angesiedelt, die anteilige Finanzierung von Kultur durch die öffentlichen Hände immer stärker unter Druck. Als "Sahnehäubchen", das man sich in schlechten Zeiten nicht leisten könne. Wie erklären Sie sich das? Und halten Sie diese Argumentation für gerechtfertigt?
Kulturförderung ist auch Wirtschaftsförderung, wie zum Beispiel der Hessische Kulturwirtschaftsbericht deutlich belegt. Demzufolge erzielten 2500 Unternehmen in der Film-, TV- und Videowirtschaft im Jahr 2000 einen Umsatz in Höhe von 2,4 Milliarden Euro, das entspricht knapp 0,6 Prozent des Umsatzes der gesamten hessischen Wirtschaft. Kultur wird in Hessen daher nicht als "Sahnehäubchen" sondern als "Tortenboden" betrachtet. Unter Druck geraten bei der schwierigen Haushaltssituation sind alle freiwilligen Leistungen, nicht nur die Kulturförderung.
Spätestens seit dem so genannten Koch-Steinbrück-Papier zum Subventionsabbau stellen sich einige Fragen zu Begrifflichkeiten, deren Klärung ein nicht unwichtiger Aspekt auch in der Kulturpolitik sein sollte. Fangen wir mit der so genannten "Subvention" an, von dem es keine eindeutige Definition gibt. Handelt es sich aus Ihrer Sicht im Bereich der Kultur um Subvention analog zur Braunkohleförderung, um ein gern zitiertes Beispiel zu nennen?
Das Koch-Steinbrück-Papier hat insgesamt eine für Deutschland sehr positive Diskussion angestoßen. Inzwischen ist nach meinen Kenntnissen klargestellt, dass Kulturförderung nicht als "Subvention" im Sinne dieses Papiers verstanden werden soll. Kulturförderung ist ja auch keine Subvention, sondern eine Investition in die Zukunft und in den Erhalt der gegenwärtigen demokratischen humanistischen Verfasstheit unserer Gemeinwesen.
Prof. Dr. Max Fuchs und Olaf Zimmermann vom Deutschen Kulturrat sehen in der Wahl des Subventionsbegriffs und der Einordnung der Kultur "mehr als eine akademische Spielerei", sondern die grundsätzliche Einordnung und Betrachtung von Kunst und Kultur durch die Politik: entweder unter einen ökonomischen Ansatz, in der Kultur eine Dienst- und Wirtschaftsleistung wie viele andere im Sinne des GATS-Abkommens ist, oder aber unter einer gesellschaftspolitische Betrachtungsweise, in der Kultur eine zentrale Rolle für Gemeinschaft und Teilhabe spielt. Zu welcher Betrachtungsweise mit welchen Schlussfolgerungen und Konsequenzen neigen Sie?
Ich verweise auf die Antwort zu Frage 2. Die Herren Fuchs und Zimmermann vermuten, zuweilen etwas zu beflissen, sofort einen Angriff auf diesen Gral, wenn die Politik nicht bei einschneidenden Maßnahmen ausdrücklich die Kultur ausklammert. Ich halte auch nichts von "entweder oder", sondern gerade bei der Kultur eher von "sowohl als auch". Gewiss gibt es auch bei der Kultur im weiteren Sinne "ökonomische Ansätze"; sehen Sie nur auf die Kulturgüter, die unstreitig gleichzeitig auch Wirtschaftsgüter sind, wie z. B. Bücher oder Filme. Aber natürlich sollte eine Betrachtungsweise überwiegen, die die ästhetischen, humanistischen, sozialen Aspekte der Kultur in den Vordergrund stellt und ihnen auch politisch Rechnung trägt. Die Problematik des GATS-Abkommens ist zwar noch nicht endgültig gelöst. Bisher konnten jedoch durch die Länder über den Bund und der Europa insoweit vertretenden EU verhindert werden, dass kulturelle Förderungen beschnitten oder erschwert werden können. Wir werden diesen Problemkreis weiter genau im Auge behalten.
Eine weitere kulturpolitische Problematik lässt sich an dem Begriff "Freiwillige Leistungen" fest machen: Einerseits reden angesichts der Krise der öffentlichen Haushalte alle von der Bedeutung und Wichtigkeit bürgerschaftlichen Engagements. Doch gerade in den Bereichen, wo viele Freiwillige vieles freiwillig leisten, sorgt der formalrechtliche Status als "freiwillige Leistung" eher für das Gegenteil: Kürzungen oder gar Wegfall einer anteiligen öffentlichen Unterstützung zugunsten festgeschriebener, aus der Tradition reichender Institutionen. Kann man hier noch von zeitgemäßer oder gar zukunftsfähiger Politik reden? Und wie kann dieses kulturpolitische, letztlich aber gesellschaftspolitische Dilemma gelöst werden?
Dazu gibt es zwei Grundsätze: Wenn kein Geld da ist, kann keines verteilt werden, und alle, insbesondere alle öffentlichen Gemeinwesen, sind an Recht und Gesetz gebunden. Daraus folgt, dass, wenn gespart werden muss, dort zu sparen ist, wo durch die Einsparungen keine Rechtsverletzung begangen wird. Das sind nun einmal die Leistungen, die nicht durch Gesetz, Vertrag oder sonstige Verpflichtung gebunden sind - also die "Freiwilligen Leistungen".
Dabei darf natürlich nicht dort umso mehr gekürzt werden, wo Freiwillige freiwillig in die Bresche springen, um das auszugleichen, was durch die öffentlichen Hände nicht mehr geleistet werden kann. Dies wird von uns auch nicht praktiziert. Dort wo freiwilliges Engagement für die Allgemeinheit und damit auch für Kultur vorhanden ist, versuchen wir im Rahmen des Möglichen besonders zu unterstützen. Trotzdem werden die öffentlichen Körperschaften immer und in schlechten Zeiten immer mehr gerade im Kulturbereich auf freiwillige Leistungen personeller und finanzieller Art angewiesen sein, um Standards aufrecht zu erhalten. Ich weiß sehr wohl, dass bei den Soziokulturellen Zentren sehr viel ehrenamtliches Engagement vorhanden ist und dass sich die viel zu wenigen "Hauptamtlichen" selbst ausbeuten, um, lax gesagt, den Betrieb am Laufen zu halten. Wir haben bei den unabdingbaren Kürzungen im Kulturbereich die Soziokultur deshalb auch soweit als möglich geschont.
Nicht wenige sehen in der Verankerung von Kultur als Pflichtaufgabe in der Landesverfassung, wie dies in Hessen schon beim Sport und Umweltschutz der Fall ist, einen notwendigen Schritt. Dies forderte ja zuletzt auch Johannes Rau in seiner letzten Phase als Bundespräsident. Wie bewerten Sie diese Forderung?
Nach meinem Verständnis ist Kultur ohnehin Pflichtaufgabe eines Landes. Wir sind auch ohne ausdrückliche Festschreibung in der Landesverfassung ein Kulturstaat. Kultur ist existenzielle Grundlage und unverzichtbarer Bestandteil einer humanen, demokratischen Gesellschaft. Die Hessische Verfassung trägt dem in Verbindung mit dem Grundgesetz Rechnung. Aus der in der dort verankerten Kulturstaatlichkeit folgen drei komplexe Aufgabenfelder von essentieller Bedeutung: Garantie der Freiheit von Kunst und Kultur, Schaffung von angemessenen Rahmenbedingungen für die Erhaltung und Entfaltung von Kunst und Kultur sowie weitgehende Öffnung des Zugangs zu Kunst und Kultur für alle. All das ist bisher in Hessen im Rahmen des Möglichen erfolgt und wird auch weiter als kulturpolitisches Ziel verfolgt werden.
Eines der wichtigsten politischen Megathemen ist neben dem Bereich der Bildung sicherlich auch die Arbeitsplatzproblematik. Nun gibt es ja mittlerweile viele Untersuchungen, die den volkswirtschaftlichen Mehrwert von Kulturförderung zu verdeutlichen suchen. Auch der 1. Hessische Kulturwirtschaftsbericht verdeutlicht, dass Kultur nicht nur als weicher, sondern längst auch als harter Standortfaktor ernst zu nehmen ist. Müsste hier Kulturpolitik nicht wesentlich offensiver die vielfältigen Potenziale der Wachstumsbranche Kultur darstellen und einbringen?
Die wirtschaftliche Komponente der Kultur hatte ich ja bereits eingangs betont. Wir haben nicht umsonst den "Kulturwirtschaftsbericht" in Auftrag gegeben. Er hat das in weit höherem Maße bestätigt, was wir bereits vermuteten. Kultur ist in der Tat ein harter Standortfaktor und wird als solcher auch in der gesamten Landesregierung betrachtet. Die Nutzung der wirtschaftlichen Potentiale von Kunst und Kultur wird erkannt und zwar nicht nur durch die Landesregierung, dort insbesondere durch das Wirtschaftsministerium, einbezogen, sondern, wie ich letztlich im Rahmen der Ballungsraumdebatte FrankfurtRheinMain feststellen konnte, auch von der freien Wirtschaft. Wir sind dabei, den Auftrag für einen zweiten Kulturwirtschaftsberichtes zu prüfen, um weitere Argumente für die Unterstützung von Kunst und Kultur im Lande zu bekommen.
Herr Leonhard, wir danken für das Gespräch.